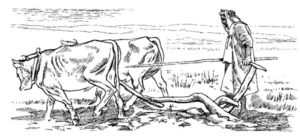Jahrtausende lebten die Menschen als Jäger und Sammler beziehungsweise als Ackerbauern und Viehzüchter, also von und mit der Natur. Und dann, in einem Zeitraum von nicht einmal hundert Jahren wurde alles anders. Maschinen dominierten jetzt den Alltag, der meist in den Städten stattfand. Dort hatten sich die Menschen bereits ein gutes Stück von ihren natürlichen Lebensgrundlagen entfernt. Gleichzeitig beschleunigte sich ihr Lebensrythmus, denn sowohl in der Produktion als auch beim Transport von Gütern und Personen gaben nun Maschinen ein bis dahin ungekanntes Tempo vor. Mit dem Einzug der Technik veränderten sich auch die Beziehungen der Menschen zueinander. Rechte und Pflichten, Reichtum und Macht wurden grundlegend umverteilt. Man vermag sich kaum vorzustellen, wie die Menschen diesen Umbruch erlebten. Ihr tradiertes Weltbild, ihre Vorstellungen vom Leben, ihre Werte und das, was sie als gesichertes Wissen verstanden, alles geriet in der Zeitspanne eines Lebens unter die Räder. Für die einen mag diese Entwicklung gleichbedeutend mit dem Untergang des Abendlandes gewesen sein, für die anderen wurde Fortschritt zum verheißungsvollen Mantra. Die meisten hatten allerdings genug damit zu tun, irgendwie zu überleben.
Meine Uroma, 1882 geboren, lebte als junge Frau alleinstehend mit einem Kind in einer märkischen Kleinstadt. Sie zog mit einem Handwagen über die Dörfer und verkaufte frisch gepresstes Leinöl, um so den Lebensunterhalt für sich und ihr Kind zu verdienen. Ihre Wohnung bestand aus einem kleinen Zimmer und einer noch kleineren Küche, in der auf einem mit Holz befeuerten Ofen gekocht wurde. Wasser musste sie von der Pumpe auf der Straße holen, während sich das Plumsklo auf dem Hof befand. Wenn es dunkelte, konnte sie im Kerzenschein noch ein wenig hantieren, aber letztlich bestimmte das Tageslicht ihren Lebensrythmus. Als sie 1968 starb, war elektrische Beleuchtung in den Wohnungen und auf den Straßen längst selbstverständlich. Jetzt verunsicherten nicht nur dunkle Gestalten sondern auch Automobile die Straßen. Man hatte die Wohnungen an das städtische Wassernetz angeschlossen, so dass Badezimmer und Klosett Alltag geworden waren. Zum Kochen stand ein Gasherd bereit. Außerdem machten ihr Staubsauger, Waschmaschine und elektrische Küchengeräte das Leben leichter. Zu all diesen Geräten gesellten sich noch Radio, Fernseher und Telefon. Mehrmals am Tag klirrten die Scheiben, weil ein Düsenjet die Schallmauer durchbrach. Und als Krönung des Ganzen waren Menschen in eine Erdumlaufbahn geschossen worden. Das war aber nur die eine Seite. Mit dem Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Faschismus und dem Sozialismus hatte sie vier politische Systeme er- und zwei Weltkriege überlebt. Die Inflation nach dem ersten großen Krieg fraß ihre mühsam gesparten Notgroschen, die folgende Weltwirtschaftskrise verschlimmerte die Lage weiter und die ständig wechselnden Regierungen waren auch nicht dazu angetan, Hoffnungen keimen zu lassen. Dann eroberte ein schnauzbärtiger Heilsverkünder die politische Bühne. Er versprach Ordnung, technischen Fortschritt und Arbeit für alle. Was er außerdem im Gepäck hatte, waren Verfolgungen, Massenmord und ein Krieg, der noch grausiger werden sollte, als der vorangegangene. Dem Krieg folgten Hunger, Ströme von Flüchtlingen und die Teilung des Landes. Blickt man auf die Stürme dieses Lebens zurück, dann erscheinen heutige Veränderungen einem lauen Lüftchen gleich.
Die erster Vorboten der großen Veränderungen waren aus England gekommen. Dort hatte man früh die Weichen in Richtung Förderung von Handwerk und Gewerbe gestellt, was besonders der Textilbranche zugute gekommen war. Feines englisches Tuch wurde zu einem Exportschlager. Es konnte gar nicht genug Schafswolle produziert werden, um die wachsende Nachfrage nach edlem Tuch zu befriedigen. Baumwolle, die aus den Kolonien ins Land kam, sollte Abhilfe schaffen und neue Käuferkreise erschließen. Doch schon bald zeigte sich, dass die Produktivität der Spinnerinnen, die die Baumwolle zu Garn verarbeiteten, zu gering war, um die schnell wachsende Nachfrage zu bedienen. Sollte es nicht möglich sein, Kräfte der Natur einzusetzen, um die Spinnerinnen zu unterstützen oder sogar ganz zu ersetzen? Schließlich hatte man die Kraft des Wassers und des Windes schon früher, wenn auch für andere Zwecke, eingesetzt. Da der Spinnprozess kontinuierlich ablaufen muss, blieb in diesem Fall allerdings nur die Wasserkraft als erfolgversprechende Option. Sie wurde dann auch in einer ersten Spinnfabrik, die 1770 ihre Produktion aufnahm, als Antriebskraft genutzt. Menschen wurden in dieser Fabrik nur noch für Hilfs- und Kontrollaufgaben benötigt. Zwanzig Jahre später gab es bereits 200 derartiger Fabriken, deren Produktivität rund 30 mal höher war als die der Spinnerinen.
Wasserkraft ist ortsgebunden und nicht überall verfügbar. Ihrem Einsatz als Antriebskraft waren daher enge Grenzen gesetzt. Energie wird aber nicht nur durch Wasser und Wind erzeugt, auch bei Verbrennungsprozessen wird Energie in Form erhitzter Gase frei. Verbrennungsprozesse haben zudem den Vorteil, dass sie im Prinzip überall ablaufen können. Sie waren also sowohl stationär, an jedem beliebigen Ort, als auch zum Antrieb von mobilen Maschinen einsetzbar. James Watt verhalf diesem Prinzip zum Durchbruch. Seine Dampfmaschinen kamen ab 1777 auf den Markt, die ersten Lokomotiven wurden ab 1804 verkauft. Zwischendurch hatten sich in Folge der französischen Revolution sowohl in Europa als auch in Nordamerika weitreichende gesellschaftliche Veränderungen vollzogen. Mit ihnen wurden Kräfte freigesetzt, die dem Fortschritt weiteren Schwung verliehen. Letztlich war es wieder das Eisen, dessen massenhafte Verarbeitung zu hochwertigem Stahl ab 1855 eine neue Etappe der Entwicklung einläutete. Aus Stahl gefertigte Maschinen dominierten bald die Produktion in den Fabriken wie auch den Transport zu Wasser und zu Lande.
Industriebetriebe entstanden vor allem in den Städten, denn dort fanden sich die erforderlichen Arbeitskräfte. Mitunter wuchsen auch neue Städte in der Nähe von Industrieanlagen, die sich bei wichtigen Rohstoffverkommen angesiedelt hatten. Der Hunger der Fabriken und Zechen nach freien Lohnarbeitern konnte jedoch nur gestillt werden, weil die Landwirtschaft durch wachsende Erträge die Ernährung einer zunehmenden Zahl von Menschen gewährleistete. Diese suchten ihr Auskommen vor allem in den Städten, die rasant wuchsen, so dass zum Ende des 19. Jahrhunderts die Landbevölkerung erstmals zur Minderheit wurde. Der Pulsschlag des gesellschaftlichen Lebens hatte sich endgültig in die Städte verlagert. Dort spielte die Musik, aber nicht für alle, denn die Menschen waren zu austauschbaren Anhängsel der Maschinen geworden, zu einem Kostenfaktor, der möglichst gering zu halten war. Bei Verschleiß stand eine Armee von Nachrückern bereit. Kinder waren besonders beliebt, da sie sich als Diener der Maschinen behende, fügsam und kostengünstig erwiesen. Das Licht des technischen Fortschritts offenbarte bedrückende Schatten. Doch es formierte sich Widerstand. Sozial motivierte Kämpfe entbrannten, erst spontan, dann zunehmend organisiert. Parteien, die den Kampf für die Rechte der Arbeiter und ihrer Familien auf ihre Fahnen schrieben, gewannen großen Zulauf.
Manche Städte wuchsen so rasant, dass ihre Infrastruktur völlig neu konzipiert werden musste. Auf Wohngebiete der ärmeren Bevölkerung wurde dabei kaum Rücksicht genommen, zumal der Wert der innerstädtischen Grundstücke unaufhaltsam stieg. Nicht nur die Preise der Grundstücke, auch die Häuser selbst schossen in die Höhe. Mit Fahrstühlen ausgestattete Wolkenkratzer waren der letzte Schrei. Die Bahn wurde dagegen schon mal in den Untergrund verlegt, um Platz zu sparen. Außerdem kam Licht in das Dunkel. Man hatte schon länger mit Elektrizität experimentiert und 1799 eine erste Batterie vorgestellt, nun, hundert Jahre später, war es soweit, dass Häuser und Straßen mit elektrischem Strom illuminiert werden konnten. Erst wenige, dann immer mehr, bis Elektrizität überall das Leben heller werden ließ. Schritt für Schritt erreichten die Segnungen der Industrialisierung breitere Kreise der Bevölkerung, viel zu langsam für die, die darauf warteten, im Rückblick gesehen jedoch in einem geradezu atemberaubenden Tempo.
Die Industrieproduktion war zur treibenden Kraft des Wirtschaftslebens geworden. Unternehmer, lange Zeit als Neureiche belächelt, bildeten die neue Oberschicht, die nach immer mehr Einfluss gierte, nicht zuletzt, weil sich ein bis dahin ungekanntes Problem aufgetan hatte. Durch den Einsatz der Maschinen war die Produktion nämlich zunehmend planbar geworden, das heißt, man konnte sie beinahe beliebig ausdehnen. Dem stand entgegen, dass die Märkte, die die Rohstoffe und Vorprodukte bereitstellen mussten und die die Endprodukte aufnehmen sollten, unberechenbar blieben. Wollte man eine den Maschinen gerecht werdende hohe Kontinuität der Produktion erreichen, mussten ganze Fertigungsketten in einer Hand vereinigt und Konkurrenten weitgehend ausgeschaltet werden. Nur ein monopolisierter Markt würde steuerbar sein. Für die Erreichung dieses Ziels schien jedes Mittel recht, jedenfalls war das die Überzeugung einiger Magnaten in den USA, deren Treiben auch dadurch begünstigt wurde, dass Grenzen setzende Regeln fehlten. Erst verheerende Krisen verhalfen zur Einsicht, dass ungezügelte Profitgier nicht automatisch gesellschaftlichen Wohlstand hervorbringt.
Das Entstehen von Wirtschaftsgiganten war aber nicht nur den Fortschritten in der Produktion und den Visionen einzelner Unternehmer zu danken. Für die Führung großer und territorial verzweigter Unternehmen brauchte man auch neuartige Möglichkeiten zur Kommunikation. Sie mussten einen schnellen Austausch von Informationen über weite Entfernungen hinweg gestatten. Der Telegraph und später das Telefon eröffneten diese Möglichkeiten. Sie gaben nicht nur der Industrie neue Perspektiven, sie schufen auch die Voraussetzung für die Beherrschung komplexer Infrastruktursysteme. Das Management eines Eisenbahnnetzes wäre ohne die technische Signalübertragung nicht denkbar. Die schnelle Übermittlung der Informationen führte aber auch auf ganz anderen Gebieten zu neuen Entwicklungen. Sie machte zum Beispiel eine zentrale Steuerung großer und schnell operierender Armeen möglich. Allerdings wurden nicht nur die Armeeführungen umgehend über aktuelle Veränderungen informiert, auch der Öffentlichkeit konnten nun Nachrichten über die tatsächliche Lage an den Fronten zugänglich gemacht werden. Zeitungen und andere Medien etablierten sich als vierte Gewalt im Ringen um politische Weichenstellungen.
Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts vollzog sich noch eine weitere Veränderung, deren Tragweite erst nach und nach in vollem Umfang erkennbar wurde. Der Austausch von Waren war bis dahin Produkt gegen Produkt beziehungsweise mit Hilfe einer als Äquivalent akzeptierten Geldware abgewickelt worden. Als solche Geldwaren hatten sich im Laufe der Zeit vor allem Edelmetalle, wie Gold und Silber, etabliert, denn sie konzentrieren einen hohen Wert in einem geringen Volumen, sind beliebig teilbar und als Material sehr beständig. Ihr Nachteil, dass sie nur begrenzt zur Verfügung stehen und ihr sicherer Transport einen relativ hohen Aufwand verursacht. Dieses Problem war allerdings nicht neu, es begleitete den Handel von jeher. Im Laufe der Zeit hatten sich daher verschiedene Wege zur einfacheren Abwicklung von Geschäften herausgebildet. Man konnte zum Beispiel Forderungen und Verbindlichkeiten von Klienten buchseitig verrechnen, ohne dass Geldware bewegt werden musste. Es war auch möglich, einen Schuldtitel gegen das eigene Vermögen oder gegen Guthaben bei Dritten auszustellen und diesen zur Bezahlung einzusetzen. Voraussetzung für derartige Transaktionen war, dass sowohl der verrechnenden Stelle als auch dem Schuldner Vertrauen entgegengebracht wurde, denn man verzichtete ja für den Moment auf die Begleichung einer Forderung, um sie zu einem späteren Zeitpunkt, vielleicht auch an einem anderen Ort, geltend zu machen. Solches Vertrauen genossen vor allem Banken, die die Abwicklung von Geldgeschäften zu ihrem Metier gemacht hatten.
Schuldscheine, die auch als Zahlungsmittel eingesetzt wurden, waren anfangs individuell, auf einen konkreten Schuldner bezogen. Später ging man dazu über, universelle, das heißt vom Staat autorisierte, Scheine in Umlauf zu bringen. Diese Papiere galten als Stellvertreter der Geldware, denn der Staat beziehungsweise eine Zentralbank garantierten, dass man bei Vorlage ihren Gegenwert in Gold erhielt. Das Versprechen, derartige Scheine jederzeit in Gold eintauschen zu können, wurde in Zeiten der sich ausweitenden Massenproduktion und des massenhaften Austausches von Gütern allerdings zu einer Gefahr, denn zwangsläufig lief bald mehr Papiergeld um, als Goldreserven vorhanden waren. Sollten die Verkäufer durch irgendwelche Ereignisse verunsichert werden, das heißt, ihr Vertrauen in die Stabilität der Märkte verlieren, würden sie ihre Forderungen sofort fällig stellen und das versprochene Gold einfordern. In einem solchen Fall würden die Banken oder staatlichen Institutionen, die diese Schuldscheine herausgegeben hatten, nicht in der Lage sein, ihr Versprechen einzulösen. Eine solche Situation konnte zum Kollaps der Märkte und letztlich ganzer Volkswirtschaften, mit unübersehbaren politischen Folgen, führen. Um dieser Gefahr vorzubeugen, musste man die Garantie der Eintauschbarkeit der Geldscheine gegen Gold aufgeben. Die Geldscheine waren damit nicht mehr Repräsentant einer Geldware, sondern nur noch bedrucktes Papier. Das mit ihnen verbundene Versprechen beschränkte sich darauf, dass die Gesellschaft die Forderungen, die mit diesem Geld dokumentiert wurden, jederzeit für die Bezahlung von Verbindlichkeiten, die aus dem Erwerb beliebiger Waren und Dienstleistungen resultierten, akzeptieren würde. Insofern wurde jeder, der Papiergeld als Zahlungsmittel annahm, zum Kreditgeber, im Vertrauen darauf, diesen Kredit jederzeit in die von ihm benötigten Waren und Dienstleistungen verwandeln zu können. Dass solches Vertrauen auch missbraucht werden kann, zum Beispiel indem deutlich mehr Papiergeld in Umlauf gebracht wird, als Waren und Dienstleistungen verfügbar sind, wurde zur bitteren Erfahrung jener Menschen, denen die Hydra einer galoppierenden Inflation die Ersparnisse raubte.
Die Industrieproduktion war zur Basis moderner Gesellschaften geworden. Sie wurde auch zur Grundlage von Macht und Einfluss der Staaten im Weltgeschehen. Deshalb war es bald ein vorrangiges Anliegen der Regierungen, die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Eine der wichtigsten Aufgaben in diesem Zusammenhang war die Schaffung einer zeitgemäßen Infrastruktur, denn der Ausbau der Transportwege für Güter, Personen und Informationen gewann sowohl für die Entwicklung der Wirtschaft als auch für die Versorgung der Städte und Armeen außerordentliche Bedeutung. Die sozialen Folgen der Industrialisierung wurden ebenfalls zur Herausforderung, denn wiederkehrende Unruhen hatten gezeigt, dass ein Mindestmaß an sozialem Ausgleich notwendig ist, um eine kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung zu sichern. Da den Unternehmern der eigene kurzfristige Profit wichtiger war, als der Blick auf die Entwicklung des Gemeinwohls, musste der Staat regulierend eingreifen. Die schweren Wirtschaftskrisen hatten zudem deutlich gemacht, dass den Unternehmen auch ökonomische Rahmenbedingungen vorgegeben werden mussten, um ihre Initiative in volkswirtschaftlich verträgliche Bahnen zu lenken. Das Eingreifen des Staates in das Wirtschaftsgeschehen berührte jedoch die Interessen der Unternehmer, die vehement eine enge Abstimmung einforderten. Die sich entwickelnde enge Verflechtung von Politik und Wirtschaft beschwor allerdings die Gefahr herauf, dass die Interessen weniger über Gemeinwohl gestellt wurden.
Im gleichen, atemberaubenden Tempo, in dem die Industrialisierung voranschritt, veränderten sich auch die Gewichte der Staaten im globalen Machtgefüge. In der vorangegangenen Epoche hatten die Europäer, vor allem Spanien, Portugal, England und Frankreich, die Welt unter sich aufgeteilt, wobei Großbritannien schlussendlich der größte Brocken zugefallen war. Die Dynamik des Maschinenzeitalters ließ jedoch tausendjährige Reiche nicht mehr zu. Neue Spieler, wie Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika, warfen schon bald ihre wachsende wirtschaftliche Potenz in die Waagschale, um im Kampf um Rofstoffe und Märkte bessere Bedingungen zu erlangen. Die internationalen Beziehungen waren auf derart dynamische Veränderungen nicht vorbereitet. Sie verharrten in einer Zeit, da der Hochadel staatliche Bündnisse ausgehandelt und durch familiäre Bande untermauert hatte. Dessen oft von Eitelkeiten gelenkte Politik gepaart mit dem Expansionsstreben des Großkapitals führte Europa schließlich in einen Krieg, der am Ende ein Weltkrieg war und Millionen Menschen das Leben kostete. Da der Krieg auch im Stile der vergangenen Epoche, mit Demütigungen und willkürlichen Machtverschiebungen, beendet wurde, geriet er zur Keimzelle weiterer Katastrophen. Immerhin, es war die letzte Schlacht des Adels, der mit dem Ende des ersten Weltkriegs endgültig von den Schalthebeln der Macht entfernt wurde. Die neuen Herren, die Herren des Geldes, waren allerdings kaum besser, nur skrupelloser.
In Russland wollten einige Revolutionäre neben dem Adel auch gleich noch das Privateigentum abschaffen, was dazu führte, dass das Land zeitweise im Elend eines Bürgerkriegs versank. Sie errichteten einen streng zentralistischen Staat, dessen Aufgabe darin gesehen wurde, das Land zu modernisieren und ihre Revolution in die Welt zu tragen. Dabei wurde auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt. In Deutschland hatte es ebenfalls eine siegreiche Revolution gegeben, eine faschistische, die sich als nicht minder blutrünstig erwies. Ihr Streben nach Weltherrschaft sollte durch einen großen Vernichtungskrieg zum Ziel geführt werden, wobei der in Russland herrschende „jüdische Bolschewismus“ zum Hauptfeind erkoren war. Russen und Juden hatten dann auch den höchsten Blutzoll zu beklagen, bevor es den Völkern der damaligen Sowjetunion gelang, den deutschen Überfall abzuwehren und gemeinsam mit den Alliierten die faschistischen Armeen vernichtend zu schlagen.
Eine Lehre dieses Krieges war die Einsicht, dass nur eine enge Zusammenarbeit der Staaten und Völker den Frieden bewahren kann. Man schuf internationale Gremien für die Sicherheit der Staatengemeinschaft sowie zur Förderung ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Zusammenarbeit. Gleichzeitig teilten die Siegermächte die Welt von neuem in Einflusssphären auf. Die in diesem Zusammenhang gezogenen Grenzen berücksichtigten die Interessen der dort lebenden Völker kaum, so dass wiederum ein beträchtliches Konfliktpotenzial angehäuft wurde. Darüber hinaus war den Großmächten bald jedes Mittel recht, um ihre Einflusssphären zu erhalten oder auszudehnen. Dazu wurden Kriege geführt, diktatorische Regimes unterstützt und Waffen in absurden Dimensionen angehäuft.
All die Katastrophen und Verwerfungen, die das 20. Jahrhundert prägten, haben den technischen Fortschritt nicht aufgehalten, im Gegenteil. Maschinen zogen immer stärker in das Leben der Menschen ein. Sie ersetzten ihre Arbeitskraft in der Industrie, in der Landwirtschaft und zunehmend auch im Dienstleistungsbereich, sie eroberten die Haushalte und sie veränderten die Kommunikation der Menschen untereinander. Trotz aller Hemmnisse vertiefte sich die Kooperation der Unternehmen über Ländergrenzen hinweg. Auf immer mehr Gebieten erwies sich internationale Zusammenarbeit als zwingend erforderlich, um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen. Gleichzeitig verstärkten sich jedoch die Ungleichgewichte zwischen den Regionen und Ländern, zum einen weil sich die unterschiedlichen Startbedingungen ohne ausgleichende Hilfen potenziert fortschrieben, zum anderen, weil die reichen Länder ihre Machtstellung nutzten, um die Bedingungen des internationalen Handels zu ihrem eigenen Vorteil zu gestalten. Hinzu kam, dass nach dem Zerfall der Sowjetunion das Denken in Einflusssphären nicht untergegangen war, höchstens in dem Sinne, dass sich die USA, respektive maßgebliche Teile der dortigen Oligarchie, darin bestätigt sahen, dass allein sie berufen seien, die Welt in ihrem Sinne zu ordnen. Die internationalen Organisationen, die gegründet worden waren, um Konflikte zu entschärfen, wurden dabei schnell hinderlich.
zuletzt geändert: 04.01.2020
Quellen
GEO Epoche Kollektion Nr. 7, Die Industrielle Revolution
GEO Epoche Nr.8, Das alte China
Quelle Bild: www.Lehrerfreund.de