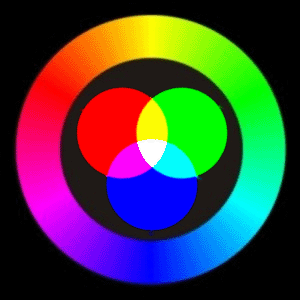Licht gehört zu den ersten Eindrücken, die ein werdender Mensch von seiner zukünftigen Umwelt aufnimmt. Bereits ab der 18. Woche der Schwangerschaft sind die Augen des Fötus lichtempfindlich. Das kann man getrost als Zeichen dafür verstehen, dass Licht eine herausragende Rolle für ihn und für sein Leben spielen wird. Es ist aber auch Indiz dafür, dass lichtempfindliche Sinneszellen bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt der Evolution entstanden sind. Die meisten Pflanzen und Tiere reagieren auf Licht. Aber, was ist Licht eigentlich?
Licht, das ist Energie in Form von Lichtquanten, Photonen genannt. Die wichtigste Licht- und damit Energiequelle für uns Erdlinge ist die Sonne, die uns mit Photonen geradezu überschüttet. Sie nähern sich uns mit einer Geschwindigkeit von rund 300.000 Kilometern in der Sekunde. Außer durch diese Reisegeschwindigkeit ist Licht durch seine Frequenz charakterisiert. Mit Frequenz bezeichnet man die Häufigkeit sich wiederholender Vorgänge in einer Zeiteinheit. Die gängige Theorie beschreibt diese sich wiederholenden Vorgänge als Schwingungen, aber auch Drehungen um sich selbst würden den Tatbestand erfüllen. Während die Geschwindigkeit, mit der die Photonen durchs Weltall reisen, für alle die gleiche ist, kann ihre Frequenz und damit ihr Energiegehalt durchaus unterschiedlich sein. Die Frequenz der für uns sichtbaren Photonen bewegt sich im Bereich von 400 bis 750 Billionen Zyklen pro Sekunde. Ich gebe zu, dieser irrwitzige Takt sprengt meine Vorstellungskraft. Trotzdem müssen wir uns der Frage stellen, wieso Photonen mit diesen Frequenzen eine wichtige Informationsquelle für uns sind. Wollten wir nur den Stand der Sonne feststellen, um ihr unser Gesicht, der Sonnenblume gleich, entgegenzustrecken, reichten einfache Sinneszellen aus. Dazu wären keine hochkomplexen Sinnesorgane, wie unsere Augen, erforderlich. Der Informationswert des Lichts hängt also nicht primär mit dem Stand der Sonne zusammen. Womit dann?
Der Informationswert des Lichts hängt damit zusammen, dass die Dinge um uns herum unterschiedlich auf die von der Sonne ausgesandten Photonen reagieren. Die einen fühlen sich von ihnen belästigt und geben die zusätzliche Energie schnell wieder ab, andere wiederum sind bereit, die ankommende Energie aufzunehmen. Die meisten Dinge sind jedoch unentschieden, sie reflektieren einen Teil der Photonen und absorbieren einen anderen. Kann man diese Unterschiede erfassén, dann ist es möglich, die Dinge voneinander abzugrenzen. Für die Erfassung der von den Dingen abgestrahlten Photonen sind unsere Augen zuständig, speziell die Stäbchen und Zapfen auf ihrer Netzhaut. Sie reagieren auf die eintreffenden Photonen, indem sie deren Energie aufnehmen und einen elektrischen Impuls generieren, der an das Gehirn weitergeleitet wird. Jeder dieser Impulse vermittelt die Information, dass ein Photon eingetroffen ist. Da sich die Rezeptoren an unterschiedlichen Stellen der Netzhaut befinden, kann die Quelle, von der das eintreffende Photon abgestrahlt wurde, ziemlich genau bestimmt werden. Hinzu kommt, dass wir die jeweilige Lichtquelle mit beiden Augen, also aus unterschiedlichen Gesichtswinkeln lokalisieren, so dass eine räumliche Vorstellung der Dinge entsteht.
Es drängt sich die Frage auf, wieso wir nur Photonen in dem eingeschränkten Bereich des für uns sichtbaren Lichts wahrnehmen können. Vermutlich wäre es für die Evolution ein Leichtes gewesen, unsere Augen für einen größeren Frequenzbereich auszulegen. Der begrenzende Faktor liegt wahrscheinlich in dem Umstand begründet, dass für die Gewinnung und Verarbeitung der Informationen so rare Güter wie Zeit und Energie erforderlich sind. Wenn man bedenkt, dass jedes unserer Augen schon jetzt rund 126 Millionen Lichtrezeptoren besitzt, dann sollte klar sein, dass eine weitere Aufrüstung an Grenzen stoßen musste. Die Beschränkung auf die für die Orientierung wichtigsten Frequenzen ist demnach nicht als Manko sondern als Optimierung zu verstehen.
Da wir zwei Arten von Lichtrezeptoren besitzen, entsteht die Frage, worin sie sich unterscheiden. Fangen wir mit den Stäbchen an. Stäbchen reagieren auf das gesamte Spektrum des für uns sichtbaren Lichts. Sie sind dabei tausendmal empfindlicher als die Zapfen. Durch ihre hohe Empfindlichkeit ermöglichen die Stäbchen das Sehen auch dann, wenn nur eine geringe Lichtmenge vorhanden ist, wenn nur wenige Photonen auf die Augen treffen. Die Kehrseite dieser Lichtempfindlichkeit ist, dass die Stäbchen bei hoher Lichtintensität keine Informationen liefern können, da für sie dann alles nur noch “hell” ist. Jedes Stäbchen liefert die Information für einen Bildpunkt, der entweder angeknipst oder ausgeschaltet ist. Angeknipst heißt, Photon ist eingetroffen und der Bildpunkt ist hell. Ist kein Photon eingetroffen, bleibt der Bildpunkt dunkel. Auf diese Weise entsteht ein Rasterbild mit hellen und dunklen Punkten. Da die Zahl der Bildpunkte deutlich höher ist als die Auflösung des Bildes, das uns das Gehirn zur Verfügung stellt, kann man diese Rasterpunkte, ähnlich wie beim Fernseher, nicht wahrnehmen. Statt eines Teppichs heller und dunkler Punkte erkennen wir helle und dunkle Flächen, aber auch solche, die weniger hell oder weniger dunkel sind. Letztere bilden eine breite Palette grau erscheinender Abstufungen.
Es ist durchaus ein Erlebnis, nachts durch einen Park zu schlendern. Der Park soll nicht beleuchtet und der Himmel eher verhangen sein, so dass nur ein geringer Rest von Licht verbleibt. Nach einiger Zeit hat sich das Auge an die Dunkelheit gewöhnt. Mehr schemenhaft als scharf zeichnen sich nun die Umrisse der nahestehenden Bäume ab. Sie sind dunkler als ihre Umgebung, da das Holz das Licht stärker absorbiert. Da taucht eine Pfütze auf. Sie verrät sich, weil an ihrer Oberfläche ein flüchtiges Sternenlicht gespiegelt wird. Oh, was war das? Da bewegte sich etwas. Es könnte ein Reh gewesen sein, dass über die Lichtung huschte. Erwacht da etwa der Jagdinstinkt? Vielleicht war es aber auch nur eine Katze. In der Nacht sind alle Katzen grau.
Je nach dem wie stark das Licht reflektiert oder absorbiert wird, erscheint das jeweilige Etwas also heller oder dunkler. Auf diese Weise grenzen sich die Dinge voneinander ab. Sie lassen sich selbst bei geringem Licht nach ihrer Helligkeit unterscheiden. Bäume werden erkennbar, Pfützen, Rehe, Katzen, auch wenn sie etwas unscharf sind und irgendwie grau erscheinen. Die Vielfalt der Graustufen eröffnet die Chance, sich auch im Dämmerlicht zurechtzufinden und mit Erfolg auf die Jagd zu gehen. Das mag für unsere Vorfahren von großer Bedeutung gewesen sein, hing ihr Überleben doch oft vom Jagderfolg ab, mitunter auch von der schnellen Flucht vor plötzlich auftauchenden Räubern. Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr verwunderlich, dass 95% der Lichtrezeptoren des Auges Stäbchen sind, obwohl wir heute eher selten auf Jagd gehen.
Für uns Heutige ist die Vielfalt des Grauen in der Dämmerung wohl eher zum Fürchten. Wir lieben es hell und bunt. Nun kommen die Zapfen ins Spiel. Es gibt drei Arten von Zapfen – S steht für short, das heißt kurze Bewegungszyklen beziehungsweise hohe Frequenzen, M für mittlere und L für lange, also geringe Frequenzen. Gemeint ist jeweils der Teil des Lichtspektrums, auf den diese Zapfen reagieren. Die Zapfen reagieren überhaupt erst ab einer bestimmten Intensität des Lichts, eigentlich erst dann, wenn die Stäbchen ihren Dienst wegen Überlastung bereits eingestellt haben. Also hell muss es sein. Die Wirkungsweise der Zapfen ist im Prinzip nicht viel anders als die der Stäbchen. Sie reagieren auf das Eintreffen von Photonen, indem sie einen elektrischen Impuls generieren, der an das Gehirn weitergeleitet wird. Der Unterschied zu den Stäbchen besteht darin, dass die Zapfen nicht auf das gesamte Spektrum des sichtbaren Lichts reagieren, sondern nur auf einen Teil desselben. Wozu soll das gut sein, könnte man fragen. Nun, die Dinge um uns herum reflektieren nicht schlechthin einen Teil des eintreffenden Lichts, wofür die Unterscheidung nach hell und dunkel ausreichend wäre, sie sind bei der Reflexion des Lichts auch noch wählerisch. Einige Teile des Lichts, mit deren Frequenzen sie etwas anfangen können, werden von ihnen absorbiert, andere wollen sie schnell wieder loswerden. Sie werden reflektiert, das heißt in Form von Photonen wieder abgestrahlt. Jedes Ding macht das auf seine Art, wodurch es zu einer spezifischen Quelle von Licht wird, eines Lichts, das jeweils nur einige Frequenzen umfasst. Diese Eigenart der Dinge zu erkennen, ermöglicht es, sie besser zu unterscheiden. Der Nachteil des Ganzen ist, dass eine riesige Menge von Informationen generiert wird, die so verarbeitet werden muss, dass sie tatsächlich hilft, sich in der Welt zurechtzufinden. Mutter Natur hat auch für dieses Problem eine Lösung gefunden – die Farben.
Ich liebe Rosen. Besonders mag ich Rosen in einem leuchtenden rot. Wieso sind die Blütenblätter dieser Rosen so wunderbar rot? Sie reflektieren vom auftreffenden Sonnenlicht halt nur den Teil mit einer Frequenz von 430 bis 480 THz. Alle anderen Lichtbestandteile werden durch die Blütenblätter absorbiert, das heißt aufgesogen. Das Resultat dieses Phänomens ist, dass nur ein Teil der Zapfen des Auges, nämlich die L-Zapfen, anspringen. Die anderen können beim Anblick der Rose nur konstatieren, dass sie nicht betroffen sind. Die L-Zapfen senden Impulse an das Gehirn, die signalisieren, dass die Blütenblätter dieser Rose Licht einer bestimmten Frequenz intensiv reflektieren, das heißt abstrahlen. Das Gehirn verarbeitet diese Impulse ebenso wie das Nichtbetroffensein der beiden anderen Zapfenarten und kommt zu dem Schluss, die Blüte dieser Rose muss satt rot sein. Der Stengel mit seinen Blättern dagegen ist grün.
Bei den Stäbchen war der Abwesenheit von Licht die Wahrnehmung “dunkel” und der Anwesenheit von Licht die Wahrnehmung “hell” zugeordnet worden. Jetzt haben wir drei verschiedene Arten von Zapfen, die Informationen über die Anwesenheit von Licht eines bestimmten Frequenzbereiches liefern und dies, wegen der vergleichsweise geringen Zahl der Zapfen, in einer deutlich geringeren Dichte als die Stäbchen. Daraus könnten Fehler bei der Interpretation nicht vorhandener Signale entstehen. Um dem vorzubeugen, gibt es die Zapfen in jeweils zwei Varianten. Die einen generieren einen Impuls, wenn ihr bevorzugtes Licht eingetroffen ist und die anderen, wenn sie leer ausgegangen sind. Das eigentliche Wunder geschieht bei der Verarbeitung dieser Impulse im Gehirn. Zuerst wird die Gesamtheit der von allen drei Zapfenarten registrierten Lichtquanten ausgewertet und ihm ein Helligkeitswert beigegeben. Die Stäbchen waren ja bereits überfordert und hatten ihren Dienst eingestellt. Außerdem wird den Signalen der einzelnen Zapfen-Arten eine Farbe zugeordnet (S-Zapfen blau, M-Zapfen grün und L-Zapfen rot). Aber woher kommt der Rest der Farbenpracht? Nun, die verschiedenen Grundfarben können miteinander kombiniert werden. Wenn zum Beispiel die L- Zapfen (rot) und die M-Zapfen (grün) das Eintreffen von Photonen registrieren und die S-Zapfen Fehlmeldung geben, dann ordnet das Gehirn dem Ganzen die Farbe gelb zu. Melden alle drei Zapfen gleichermaßen Photonen, dann ist der zugeordnete Sinneseindruck weiß. Falls alle drei Zapfen das Fehlen von Photonen registrieren, kann nur schwarz die Folge sein. So weit so gut, doch wie entstehen die Farbübergänge?
Bisher haben wir so getan, als gäbe es um uns herum nur reine Oberflächen, die die Lichtstrahlen einer bestimmten Frequenz reflektieren, oder eben nicht. Stoffe sind aber nicht rein. Im Gegenteil, es herrschen Mischungen vor. Das bedeutet, dass der Farbeindruck, der von einer Oberfläche hervorgerufen wird, eigentlich eine Mischung von mehr oder weniger regelmäßig verteilten Farbpunkten sein müsste. Das wäre für die Orientierung in der Umwelt jedoch mehr verwirrend als hilfreich. Deshalb werden Farbpunkte, die relativ regelmäßig auf der Oberfläche verteilt sind, zu einem einheitlichen Farbeindruck verschmolzen. Da die Anteile der einzelnen Farbpunkte unterschiedlich ausfallen können, was ein wichtiges Merkmal für die Unterscheidung der Dinge wäre, wird dieser Farbeindruck als Abwandlung der Grundfarbe interpretiert. Auf diese Weise entsteht eine ganze Palette von Farben und Farbtönen mit einer Vielzahl von Nuancen. Sind die Beimengungen nicht gleichmäßig verteilt sondern unregelmäßig platziert, könnte auch dies eine wichtige Information sein. Die Unterschiede in der Oberfläche werden in einem solchen Fall nicht durch einen einheitlicher Farbeindruck zugedeckt, sondern sie bleiben als Flecken oder sonstige Muster erkennbar.
Noch immer ist nicht recht klar, wie aus dem Gemisch von Farbpunkten ein ganzheitlicher Farbeindruck entsteht. Es gibt da ein Phänomen, das uns vielleicht weiterhelfen kann- die Metamerie. Damit benennt man den Fakt, dass unser Gehirn unterschiedlichen Kombinationen von Photonen mitunter den selben Farbton zuordnet, obwohl sie doch eigentlich eine unterschiedliche Farbigkeit aufweisen sollten. Für dieses Phänomen gibt es eigentlich nur eine Erklärung, nämlich, dass das Gehirn den Impulsen der einzelnen Zapfen einen Wert beigibt und dann die gesammelten Werte miteinander verrechnet. Auf diese Weise entsteht ein rechnerischer Farbwert, dem ein Farbton für die gesamte betrachtete Teilfläche zugeordnet wird. Das heißt aber auch, dass die Farbigkeit der Dinge erst im Gehirn entsteht.
Da unsere Augen die von den Dingen abgestrahlten Photonen registrieren, hat natürlich auch die Zusammensetzung des auf die Dinge auftreffenden Lichts Einfluss auf die Farbwahrnehmung. So kann sich der Farbeindruck mit dem Stand der Sonne verändern, zum Beispiel dann, wenn sich die Sonne dem Horizont nähert und einzelne Lichtanteile durch den schrägen Einfallwinkel stärker von der Atmosphäre reflektiert werden als andere. Noch augenscheinlicher ist der Einfluss der Lichtquelle auf den Farbeindruck bei künstlichem Licht, da dieses meist anders als das Sonnenlicht zusammengesetzt ist. Deshalb sollte man Kleidungsstücke nur kaufen, wenn man sie auch bei Tageslicht gesehen hat. Wenn aber die Zusammensetzung des Lichts Einfluss auf unsere Farbwahrnehmung hat, dann kann die Farbe keine originäre Eigenschaft der Dinge sein.
Hell und dunkel wie auch Farben und Farbtöne nehmen wir mit unseren Augen wahr, deren Rezeptoren beim Eintreffen von Photonen elektrische Impulse an das Gehirn senden. Weder die Photonen, die sich nur in ihrer Frequenz unterscheiden, noch die elektrischen Impulse haben eine Farbe oder einen Helligkeitswert. Diese entstehen erst im Gehirn. Sie sind eine vom Gehirn erzeugte Fiktion, die uns helfen soll, die generierte Informationsflut zu überblicken und sicher in unserer Umwelt zu agieren.
An dieser Stelle sei auf den zweiten Teil verwiesen, wo mit dem sich inhaltlich anschließenden Kapitel zu „hell und dunkel“ eine Einführung in das dialektische Denken gegeben wird.
Bilder: Artikelbild – 4ever.eu, s/w Landschaft – kölnbilder.de, Farbkreis – ostalbquilter.de
zuletzt geändert: 04.04.2019